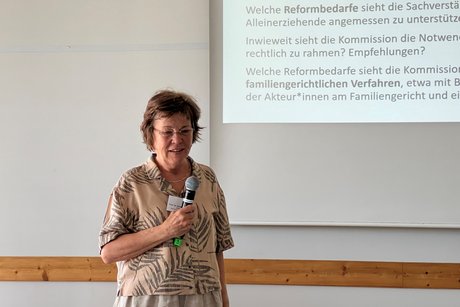Wenn Trennung in die Armut führt
Welche Herausforderungen haben Alleinerziehende und wie können sie besser unterstützt werden? Darum geht es im zehnten Familienbericht der Bundesregierung. Dieser wurde bei einer Fachtagung in Homburg vorgestellt, die der Alleinerziehenden-Verband VAMV organisiert hatte.

„Es kann nicht sein, dass die Armutsgefährdung von der Familienform abhängt“, sagte Prof. Michaela Kreyenfeld bei einer Fachtagung in Homburg, zu der der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) im Rahmen seiner Bundesdelegiertenversammlung Mitte Juni eingeladen hatte – diese fand anlässlich des 50. Jubiläums des saarländischen Landesverbands in Homburg statt. Kreyenfeld ist Mitglied der Sachverständigenkommission, die den zehnten Familienbericht erarbeitet hat. Dieser wurde Anfang 2025 veröffentlicht unter dem Titel „Unterstützung allein- und getrennterziehender Eltern und ihrer Kinder“.
Doch die hohe Armutsgefährdung von Alleinerziehenden, insbesondere Frauen, lässt sich mit Zahlen aus dem Familienbericht belegen: So beziehen 35 Prozent der Ein-Eltern-Familien SGBkurz fürSozialgesetzbuch II-Leistungen, also Bürgergeld, im Gegensatz zu nur 6,5 Prozent der Paarfamilien. Bei Alleinerziehenden mit drei und mehr Kindern liegt die Bezugsquote sogar bei 70 Prozent.
Dafür gibt es mehrere Gründe. So machte Kreyenfeld deutlich, dass das Erwerbseinkommen geschiedener Frauen rund 50 Prozent unter dem Durchschnittseinkommen liegt. Ein Grund dafür ist die hohe Teilzeitquote. Alleinerziehende Frauen arbeiten im Schnitt 20 Wochenstunden, alleinerziehende Väter 30 Wochenstunden. Bei verheirateten Frauen ist die Stundenzahl noch niedriger, während verheiratete Männer nahezu Vollzeit arbeiten. „Wie die ökonomische Situation von Alleinerziehenden aussieht, wird also schon wesentlich vor der Trennung bestimmt“, sagte Kreyenfeld.
Nach der Trennung erhöhen Mütter ihre Erwerbstätigkeit, während Väter diese reduzieren. So lag die Erwerbsquote von alleinerziehenden Müttern 2021 bei 72 Prozent (66 Prozent in Paarfamilien), bei alleinerziehenden Vätern bei 79 Prozent (90 Prozent in Paarfamilien).
Um die ökonomische Eigenständigkeit beider Elternteile zu unterstützen, empfiehlt die Sachverständigenkommission deshalb unter anderem eine Reform des Elterngeldes, den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung und eine stärkere familienzeitpolitische Gestaltungsfunktion im Arbeitszeitrecht.
Ein weiterer Grund für die hohe Armutsgefährdung und niedrige Einkommen ist die fehlende Berufsausbildung: So hat die Hälfte aller alleinerziehenden Frauen im SGBkurz fürSozialgesetzbuch II-Bezug keinen Berufsabschluss. Je geringer der Bildungsabschluss, desto geringer ist auch die Erwerbsquote. Auch das Alter des Kindes wirkt sich aus: Je jünger, desto höher die Abhängigkeit von Sozialleistungen.
Betreuung ungleich verteilt
Zentral sei deshalb ein Ausbau der Betreuungsinfrastruktur. Hier hätten Alleinerziehende einen ungedeckten Bedarf von 34 Prozent, im Gegensatz zu 22 Prozent bei Paarfamilien. In Deutschland hapert es aber nicht nur an der Infrastruktur, auch die Betreuung durch den anderen Elternteil ist im europäischen Vergleich niedrig. So übernachteten laut Familienbericht acht Prozent der Kinder von Eltern, die sich getrennt haben, mindestens zehn Tage bei dem Elternteil, der sie nicht überwiegend betreut. Nur bei drei Prozent sind es 15 Nächte, also eine geteilte Betreuung. In Schweden liegt dieser Anteil bei 42 Prozent. Bei mindestens zehn Tagen liegen Schweden (53 Prozent), Dänemark (40 Prozent) und Finnland (32 Prozent) vorne, gefolgt von Belgien, Spanien und Frankreich – dort sind es 24 Prozent.
In Deutschland verbringt mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Kinder bis zu sieben Nächte beim nicht überwiegend betreuenden Elternteil. 29 Prozent der Kinder haben zwar Kontakt zum anderen Elternteil, übernachten aber nicht dort. Bei 22 Prozent besteht gar kein Kontakt – wobei hier auch verstorbene Elternteile in die Statistik einfließen. Klar ist jedoch: je geringer der Betreuungsanteil des anderen Elternteils, desto höher sei die Armutsgefährdung und Abhängigkeit von Sozialleistungen.
Statistik-Probleme
Es gelte auch, einen kritischen Blick auf amtliche Statistik und Definitionen zu werfen, betonte Kreyenfeld. In der Statistik sind Alleinerziehende Personen, die mit einem oder mehr Kindern zusammen im Haushalt leben. Familienstrukturen, die die Haushaltsgrenzen überschreiten, werden nicht erfasst. „Das hat zur Folge, dass Eltern nicht als Eltern erfasst werden, wenn die Kinder nicht im Haushalt leben. In erster Linie sind das Trennungsväter, über die wir nichts wissen“, sagt Kreyenfeld. Im Englischen gebe es dafür den Begriff „non resident parents“. Auch das Wechselmodell, bei dem die Kinder zu gleichen Teilen beim jeweiligen Elternteil wohnen, werde statistisch nicht erfasst.
Umgekehrt bedeutet dies aber auch: Sobald ein neuer Partner oder eine neue Partnerin in den Haushalt einzieht, wird der Haushalt als Paargemeinschaft klassifiziert. In der Folge gilt der Elternteil nicht mehr als alleinerziehend, was sich unter Umständen den Anspruch auf Sozialleistungen auswirkt – egal, ob sich der oder die neue Partnerin an der Kinderbetreuung beteiligt. „Die Statistik geht einfach davon aus, dass der neue Partner die Rolle eines Stiefelternteils einnimmt,“, sagt Kreyenfeld. Steuerrechtlich gesehen ist die Person dann nicht mehr alleinstehend und verliert dadurch den Anspruch auf den Alleinerziehenden-Entlastungsbetrag (Steuerklasse 2).
Hohe Steuerlast
Kritik äußert der Familienbericht daran, dass Alleinerziehende steuerlich stärker belastet als Verheiratete. „Das Haupt- und Zuverdienendenmodell, das durch das Sozial- und Steuerrecht (z. B. durch das Ehegatten-Splitting) weiterhin privilegiert wird, benachteiligt zwangsläufig allein- und getrennt erziehende Eltern“, heißt es. Hinzu kommt, dass sich die Entlastung bei geringen Einkommen deutlich weniger stark auswirke. Im internationalen Vergleich zeige sich, dass der deutsche Staat auf die Einkommen der Alleinerziehenden besonders stark zugreife. „Alleinerziehende haben gegenüber verheirateten Paaren mit Kindern eine erhöhte Steuerlast zu tragen, obwohl ihre Leistungsfähigkeit als Hauptbetreuende stärker eingeschränkt ist“, so der Bericht.
Aktuell leben in Deutschland laut Bundesfamilienministerium 1,7 Millionen Ein-Eltern-Familien mit 2,5 Millionen Kindern unter 18 Jahren. Der Väter-Anteil liegt demnach bei 18 Prozent. „Diese Zahl ist ein Artefakt“, so Kreyenfeld. Grundlage sei hier nämlich, dass im Mikrozensus, welche als Datenquelle dient, Befragte selbst einschätzen dürfen, wer zum Haushalt gehört. Sprich: Getrennte Elternteile können sich als alleinerziehend bezeichnen, auch wenn das Kind nur teilweise bei ihnen lebt. „Das verzerrt die Statistik und führt zu Doppelzählungen.“ Bis 2005 sei die Statistik noch verzerrter gewesen, da bis dahin auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften unter dem Begriff alleinerziehend erfasst wurden.
Der Familienbericht spricht bei Alleinerziehenden von einem „Dilemma, das bislang durch das Zusammenwirken von Unterhalts-, Sozial- und Steuerrecht nicht ausreichend behoben wird“, nämlich das Fehlen einer zweiten erwerbstätigen Person bei gleichzeitig häufig alleiniger Zuständigkeit für die alltägliche Betreuung der Kinder.
Kindesunterhalt oft zu gering
Ein häufiges Problem von Alleinerziehenden sind ausbleibende oder zu geringe Kindesunterhaltsleistungen, die der nicht überwiegend betreuende Elternteil leisten muss. Nur ein Drittel aller Kinder in Ein-Eltern-Familien erhalte Kindesunterhalt in einer Höhe, die das Existenzminium decke, sagte Dr. Kirsten Scheiwe, ebenfalls Mitglied der Sachverständigenkommission. Hier gebe es zu wenig Daten und Forschung.
Rund 830.000 Alleinerziehende erhalten Unterhaltsvorschuss vom Staat, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Seit 2008 wird vom Mindestunterhalt das komplette Kindergeld abgezogen, so dass der Vorschuss um 127 Euro niedriger ausfällt als der Mindestunterhalt, der der andere Elternteil leisten müsste. Bei Kindern bis fünf Jahre sind das 227 Euro monatlich (statt 354 Euro). Auch das ist ein Armutsrisiko: 70 Prozent der Eltern, die den Vorschuss erhalten, beziehen SGBkurz fürSozialgesetzbuch II-Leistungen. Die Expertenkommission fordert deshalb, nur noch den hälftigen Kindergeldbetrag auf den Unterhaltsvorschuss anzurechnen.
Ein weiteres Problem seien Schnittstellenprobleme bei Sozialleistungen, die sich aus der Komplexität des Sozialrechts sowie verschiedenen Einkommensbegriffen und Anrechnungsraten ergeben – woran letztendlich auch die Kindergrundsicherung gescheitert sei. Diese hätte laut Bericht gerade für Alleinerziehende mit Kindern unter sechs Jahren eine „erhebliche finanzielle Besserstellung“ bewirkt. Gerade bei Alleinerziehenden könne die parallele Anrechnung von Unterhalt als Einkommen des Kindes sowohl beim Kinderzuschlag als auch beim Wohngeld dazu führen, dass die Familie am Ende weniger Geld bekommt (sogenannter „Transferentzug“).
Für die Bekämpfung von Kinderarmut sei die Ermittlung des Existenzminimums von Kindern daher zentral. Die Kommission empfiehlt sogar, das Existenzminimum von Kindern grundlegend neu zu bestimmen. Bei der Ermittlung der Bedarfe sollten die Ausgaben von Eltern der gesellschaftlichen Mitte zugrunde gelegt werden, damit die Regelbedarfe nicht zu gering ausfallen und dadurch Entwicklungspotenziale von Kindern aus Grundsicherungshaushalten einschränken.
Weitere Forderungen der Kommission, um Armut zu reduzieren: Eine bessere Berücksichtigung umgangs- und betreuungsbedingter Mehrbelastungen im Sozial- und Steuerrecht, eine stärkere steuerliche Entlastung von Alleinerziehenden, die Stärkung der gemeinsamen Elternverantwortung und der Abbau bürokratischer Hürden, um die Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen zu steigern. Zusätzliche Kosten, die durch Umgang und Mitbetreuung entstehen, wenn Kinder in zwei Haushalten aufwachsen, sollten durch einen pauschalierten Mehrbedarf berücksichtigt werden. Eine weitere Empfehlung, die bereits im neunten Familienbericht formuliert wurde, ist zudem die Schaffung besserer familienrechtlicher Regelungen, wenn nicht verheiratete Eltern sich trennen.
Zehnter Familienbericht
Der zehnte Familienbericht mit dem Titel “Unterstützung allein- und getrennterziehender Eltern und ihrer Kinder” ist Anfang Januar veröffentlicht worden. Er kann auf der Externer Link:Seite des Bundesfamilienministeriums heruntergeladen werden.