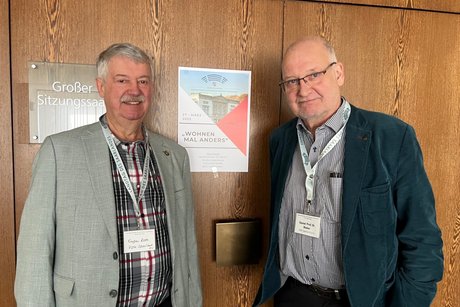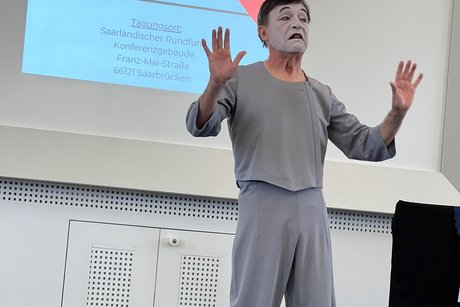„Wir brauchen flexiblere Wohnformen“
Viele Menschen mit Behinderungen würden gerne selbstbestimmter leben. Doch die Strukturen im Saarland sind starr und wenig durchlässig. Auf einer Fachtagung des Landesbehindertenbeauftragten in Saarbrücken wurden alternative Modelle diskutiert.

Man könnte sie auch „Flexibilitätstagung“ nennen – so die Worte des Landesbehindertenbeauftragten Michael Schmaus, der Ende März zu einer Tagung über alternative Wohnformen für Menschen mit Behinderungen beim Saarländischen Rundfunk auf den Halberg eingeladen hatte. Denn die Strukturen im Saarland sind starr und wenig durchlässig, ein Wechseln zwischen stationären und ambulanten Modellen schwierig. „Es gibt viele Menschen, die gerne in einer eigenen Wohnung leben würden. Aber die Vorstellung, dass sie nachts niemanden rufen können und auf sich gestellt wären, hält viele ab. Für diese Bedarfe brauchen wir mehr Flexibilität, sprich unbürokratische Lösungen. So können wir für mehr Inklusion sorgen“, so Schmaus.
Im Saarland gebe es zwar alternative Wohnformen, aber vorrangig in Modellprojekten, ergänzt Klaus Posselt, Geschäftsführer der Oberen Lebenshilfe Saar. Das Problem sei der hohe bürokratische Aufwand, da jede Leistung individuell beantragt und genehmigt werden müsse. Aus rechtlichen Gründen sei es zudem nicht möglich, dass eine Pflegekraft, die nachts im stationären Wohnheim Rufbereitschaft hat, Personen im ambulanten Bereich versorgen dürfe. „Hier müsste ein Wechsel zwischen den Wohnformen unbürokratischer möglich sein, ohne dass sich finanziell etwas für den Träger ändert oder ein langes Antragsverfahren erforderlich ist“, unterstreicht Schmaus.
Es brauche unbürokratische Lösungen, sagte Dirk Schwarz, der bei der reha GmbH zuständig für selbstbestimmtes Wohnen ist. „Viele Angehörige fragen: Was wäre, wenn? Wenn nachts ein Bedarf besteht? Solange wir auf diese Fragen keine Antwort geben können, trauen sich viele nicht raus aus dem stationären Bereich“, sagt Schwarz.
Eine Lösung könnte das Hamburger Trägermodell sein, das bei der Tagung vorgestellt wurde. In der Hansestadt vereinbart die Sozialbehörde zusammen mit den Trägern der Eingliederungshilfe ein Budget, das über fünf Jahre läuft. „Einzelabrechnungen für jede Person und Leistung sind ein hoher Verwaltungsaufwand. Das gibt es bei uns nicht mehr“, sagt Ingo Tscheulin, der bei der Sozialbehörde für den Bereich Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zuständig ist. Statt Einzelleistungen verhandelt die Behörde mit den Trägern ein Gesamtbudget, das in monatlichen Raten ausgezahlt wird. In sogenannten Steuerungsgruppen werde drei bis vier Mal im Jahr überprüft, ob die Leistungen tatsächlich ankommen. „Im alten Modell gab es viel zu wenig Flexibilität und keinen Anreiz, Teilhabe-Einschränkungen abzubauen. Das Bundesteilhabegesetz steht jedoch für stärkere Personenzentrierung und die Frage: Was braucht der Mensch?“, so Tscheulin.
Dafür gibt es in Hamburg sogenannte Teilhabe-Lotsen, die ermitteln, wie ein Mensch mit Behinderung leben möchte, welche Unterstützung dafür notwendig ist und welche Möglichkeiten im sozialen Umfeld erschlossen werden können, erklärt Stefani Burmeister, Vorständin der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Ziel sei auch, mehr Teilhabe und Treffpunkte im Quartier zu schaffen, um Einsamkeit entgegenzuwirken. Der Abbau von besonderen, stationären Wohnformen sei durch finanzielle Anreize unterstützt worden, so dass in den vergangenen Jahren viel mehr Menschen das selbstbestimmte Wohnen oder Wohnen mit Assistenz nutzten. „Wir beziehen die Menschen viel mehr ein und haben festgestellt: Sie können mehr, als wir ihnen zugetraut haben.“
Die neue Logik habe nichts mehr mit den alten Abrechnungen zu tun. „Wir haben die Eingliederungshilfe vom Kopf auf die Füße gestellt“, sagt Burmeister. Der Vorteil sei, dass die Träger fünf Jahre Planungssicherheit hätten. „Dadurch haben wir nicht mehr den Druck, alle Plätze in einer stationären Form besetzen zu müssen, um finanziell über die Runden kommen. Dennoch muss klar sein: Es ist kein Einsparmodell, man braucht nicht weniger Personal. Es ist viel Arbeit, die aber mit mehr Transparenz einhergeht, weil wir genau nachweisen müssen, wen wir wie erreichen.“ Der Grund, dass es in Hamburg so gut klappt, sei auch: Träger und Sozialbehörde würden an einem Strang ziehen und einander vertrauen.
Das nicht vorhandene Vertrauen zwischen den Behörden, die die Leistungen finanzieren, und den Einrichtungsträgern war ein Schwerpunkt der anschließenden Diskussion. Hier müssten beide Seiten über ihren Schatten springen, forderte Schmaus und zeigte sich überzeugt, dass das Hamburger Modell auch im Saarland umgesetzt werden könne. Bei der Tagung wurde zudem eine inklusive WG aus Berlin und ein inklusives Projekt genossenschaftlichen Wohnens vorgestellt.
Die Vertreter der Einrichtungen betonten den hohen Kostendruck, so dass es an Mut fehle, Neues auszuprobieren. Ein weiteres Problem sei der Personalmangel. Zwar gebe es theoretisch Plätze in der Kurzzeit-Pflege, um pflegende Angehörige zu entlasten, jedoch fehle das Personal, um diese zu betreiben. Ähnlich sei es bei Menschen, die wieder zurück in ein stationäres Wohnheim möchten: Auch hier fehlten Plätze.
Sozialminister Magnus Jung sprach sich für mehr individuelle Wohnformen und passgenaue Hilfen aus und nannte den Personalmangel als ein zentrales Problem. Um den Bedarf besser einschätzen zu können, habe das Ministerium das Beratungsunternehmen „Consens“ mit einem zweiten Gutachten beauftragt, das Ende des Jahres vorliegen soll. Das erste Gutachten war 2015 veröffentlicht worden. Die stellvertretende Landtagspräsidentin Christina Baltes (SPDkurz fürSozialdemokratische Partei Deutschlands) und der Landtagsabgeordnete Hans Hermann Scharf (CDUkurz fürChristlich Demokratische Union) plädierten für eine Anhörung im Landtag mit dem Ziel, alle Akteure an einen runden Tisch zu bekommen.