
„Viele Depressionen haben keinen erkennbaren Grund“
Was genau ist eine Depression und wie kann sie behandelt werden? Darüber klärte der ehemalige Gesundheits- und Krankenpfleger Tobias Peters auf.
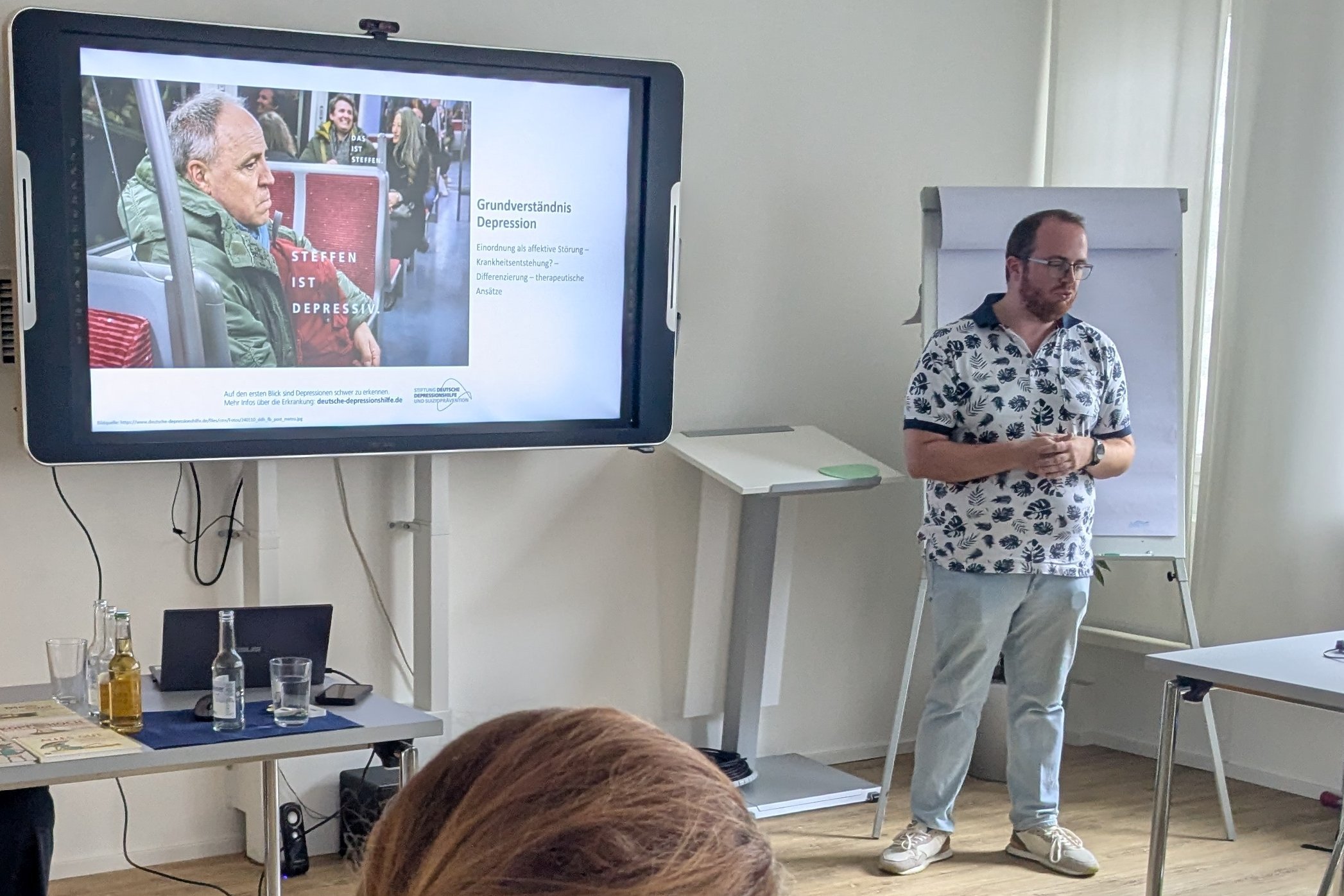
Wann ist Depression eine Erkrankung und nicht einfach nur ein Gefühl, das wieder vorübergeht? Darüber klärte der ehemalige Gesundheits- und Krankenpfleger in der Akutpsychiatrie, Tobias Peters von der SHG Bildung bei einem Vortrag der VdK-Akademie auf. „Depression ist mehr als „Ich hann die Flemm“, macht Peters klar. Die Krankheit zeichne sich dadurch aus, dass es sich um einen Dauerzustand handle. „Die Depression muss abgegrenzt werden von einer depressiven Verstimmung als Lebensphase, die jeder mal erleben kann. Die Depression als Erkrankung macht im Wesentlichen aus, dass sie lebensbedrohlich ist, weil sie ein hohes Suizidrisiko hat“, erklärt Peters.
Das Wort „depressio“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet niederdrücken. Hauptsymptom der Depression sei die Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit, die dazu führe, dass ein Mensch seinen Tag und bestimmte Aufgaben nicht mehr bewältigen kann. „Ein depressiver Mensch zieht sich immer mehr zurück. Er interagiert immer weniger mit seiner Umwelt, weil sein inneres, emotionales Erleben nicht mehr an der Außenwelt teilhaben kann, bis hin zu Suizidgedanken. Dieser Prozess ist schleichend, das macht die Depression so gefährlich“, sagt Peters. Weitere Symptome seien Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen, mangelndes Selbstwertgefühl, Perspektivlosigkeit und der Verlust an Freude an sonst angenehmen Tätigkeiten wie zum Beispiel Wandern.
Angst vor Psychiatrie
Ein weiteres Problem sei, dass viele Betroffene Angst hätten, zum Arzt zu gehen. „Die Psychiatrie wird immer noch häufig mit einem Irrenhaus in Verbindung gebracht. Auch das Bild von Zwangsjacken und Gummizellen kursiert noch in vielen Köpfen, obwohl diese praktisch nicht mehr benutzt werden“, sagt Peters.
Auch auf die Ursachen von Depressionen geht der Dozent ein. Da dahinter auch andere organische Erkrankungen wie zum Beispiel der Schilddrüse stecken können, die zu Funktionsstörungen im Gehirn oder im hormonellen System zur Folge haben, sei die körperliche Untersuchung so wichtig. Auslöser können zudem Traumata sein wie der Verlust von Beziehungen oder Todesfälle. Neben familiärer Prägung, Genetik und hormonellen Veränderungen spiele auch die Persönlichkeitsstruktur eine Rolle, ob jemand eine Depression bekommt. Peters macht aber auch deutlich, dass eine Depression „endogen“ sein kann – also ohne äußeren Auslöser: „Viele Depressionen haben keinen erkennbaren Grund.“
Schwer zu erkennen
Depressionen werden in verschiedene Typen unterteilt. Bei einer „agitierten“ Depression etwa ist der Betroffene rastlos und verfügt noch über einen starken Antrieb. Bei der „larvierten“ Depression ist der erkrankte Mensch hoch funktional und erfüllt weiterhin seine Aufgaben, so dass diese Form für Außenstehende besonders schwer zu erkennen ist. Eine Depression kann chronisch werden, so dass der Mensch sein ganzes Leben als depressiv gilt. Je nachdem, wie stark die Depression die Lebensführung einschränkt, kann sie als Behinderung mit entsprechenden Nachteilsausgleichen geltend gemacht werden.
Bei der Genesung gelte es, sich selbst und mögliche Stressoren zu erkennen und zu lernen, mit äußeren Widerständen umzugehen (sogenannte Resilienz). Ziel einer Therapie sollte laut Peters sein, einen Menschen zu befähigen, wieder Herr oder Frau des eigenen Lebens zu sein, Eigenverantwortung zu übernehmen, die eigenen Defiziten anzuerkennen, Selbstwirksamkeit zu erleben, sich als Architekt des eigenen Lebens zu fühlen und einen Sinn darin zu sehen. Zu lernen, den eigenen Alltag wieder zu strukturieren und zu bewältigen – das gelinge am besten zuhause mit Unterstützung durch therapeutische Angebote.
Stationäre Reha-Aufenthalte hält Tobias Peters für die meisten psychiatrischen Erkrankungen nicht geeignet, weil sie die Betroffenen nach einer langen Wartezeit auf die Reha aus der Routine reißen würden und die Umsetzung nicht lebensnah, im Alltag der Betroffenen, stattfinde. Nach der Rückkehr nach Hause bestehe die Gefahr, in ein großes Loch zu fallen.
Kein Allheilmittel
Auch Medikamente seien kein Allheilmittel. „Medikamente können lediglich eine Krücke sein. Sie sind keine eigenständige Therapie!“, macht Peters deutlich. Antidepressiva sollen einen Mangel an Botenstoffen im Gehirn wie Serotonin und Noradrenalin ausgleichen. Um eine Verbesserung zu bewirken, müssen sie mindestens 14 Tage am Stück eingenommen werden. Häufig müssten mehrere Medikamente ausprobiert werden, bis das passende gefunden wird, so Peters. Da sich in den ersten Tagen trotz negativer Stimmung der Antrieb erhöhe, sei es wichtig, in dieser Phase nicht allein zu sein. Bei Suizidgedanken sei ein stationärer Aufenthalt deshalb ein Muss.
Dem Umfeld von Betroffenen empfiehlt er, für den Menschen da zu sein und Hilfe anzubieten – aber ohne Zwang. Beim Umgang mit Depressiven sei sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen gefordert.
Hilfsangebote im Saarland
Im Saarland gibt es ein großes Netz an Hilfsangeboten. Einen Überblick bietet der „Externer Link:Wegweiser zu psychiatrischen Angeboten im Saarland“.
Erfahrungsbericht


